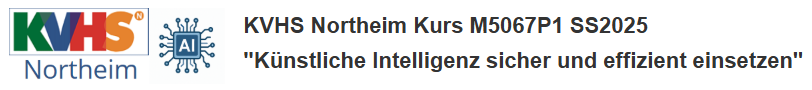
| Inhalt |
III. Erwägungsgründe
Die Erwägungsgründe (Recitals) sind ein ganz entscheidender Teil jeder EU-Verordnung, also auch des AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689). Man spricht im Deutschen oft von den „Gründen“ oder „Motiven“ des Gesetzgebers.
Die Erwägungsgründe sind im Amtsblatt als Teil des Vorspanns veröffentlicht (vor den Artikeln). Sie sind nicht direkt rechtsverbindlich, werden aber von Gerichten, Behörden und Unternehmen zur Auslegung der Artikel herangezogen.
Im Fall des AI Acts gibt es über 170 Erwägungsgründe (nummeriert (1)–(173)).
III. Erwägungsgründe des AI Act – Überblick & Detaillierte Beschreibung
1. Zweck und Kontext (Erwägungsgründe 1–15)
Stellen klar, warum die Regulierung notwendig ist:
- KI ist eine Schlüsseltechnologie mit großem Potenzial für Innovation, Wachstum und Wohlstand.
- Zugleich bestehen erhebliche Risiken für Grundrechte, Demokratie, Gesundheit und Sicherheit.
Ziel:
- Harmonisierung im Binnenmarkt (damit nicht jedes Land eigene KI-Gesetze erlässt),
- Förderung von Vertrauen in KI durch klare Regeln,
- Balance zwischen Innovation und Schutz.
Bezug zu anderen EU-Regeln: DSGVO (Datenschutz), Produktsicherheitsrecht, Grundrechtecharta.
2. Anwendungsbereich & Geltung (Erwägungsgründe 16–34)
Klarstellung, dass die Verordnung gilt für:
- Anbieter, die KI in der EU in Verkehr bringen,
- auch Anbieter außerhalb der EU, wenn ihre Systeme in der EU genutzt werden (extraterritoriale Wirkung).
Ausnahmen:
- militärische/verteidigungspolitische Zwecke,
- private Nutzung im nichtberuflichen Bereich,
- reine Forschung & Entwicklung.
KI soll menschenzentriert sein und die Werte der Union respektieren.
3. Begriffsbestimmungen & Abgrenzung (Erwägungsgründe 35–55)
- Begründung, warum die Definition von „KI-System“ bewusst weit gefasst wurde.
- Klarstellung: Nicht jede Software ist KI – KI zeichnet sich durch autonome Lern- oder Anpassungsmechanismen aus.
- Abgrenzung zu „klassischer Software“ ohne maschinelles Lernen.
- Einführung zentraler Begriffe wie „Hochrisiko-KI“, „Anbieter“, „Betreiber“.
4. Verbotene Praktiken (Erwägungsgründe 56–70)
Hintergrund zu den in Artikel 5 verbotenen KI-Praktiken.
Beispiele:
- Manipulation durch subliminale Techniken,
- Ausnutzung von Schwächen von Kindern/Behinderten,
- Social Scoring nach chinesischem Vorbild,
- Echtzeit-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum.
Erwägungsgründe betonen die Gefahren für Demokratie und Grundrechte.
5. Hochrisiko-KI-Systeme (Erwägungsgründe 71–108)
Rechtfertigung der Risikoklassifizierung (Art. 6, Anhang III).
Begründung: Hochrisiko dort, wo KI über Leben, Chancen und Grundrechte von Menschen entscheidet.
Bereiche wie Bildung, Arbeit, Justiz und Migration besonders sensibel.
Notwendigkeit strenger Anforderungen (Art. 9–15):
- Risikomanagement,
- Datenqualität,
- technische Dokumentation,
- menschliche Aufsicht,
- Robustheit und Cybersicherheit.
6. Transparenzverpflichtungen (Erwägungsgründe 109–118)
Rechtfertigung der Regeln für:
- Chatbots → Pflicht zur Kennzeichnung („Ich bin KI“),
- Emotionserkennung, biometrische Kategorisierung → Informationspflicht,
- Deepfakes → Pflicht zur Kennzeichnung.
Ziel: Vermeidung von Täuschung, Stärkung von Verbrauchervertrauen.
7. General Purpose AI (GPAI) (Erwägungsgründe 119–134)
Hintergrund für die Aufnahme von Foundation Models / GPAI.
GPAI ist nicht automatisch Hochrisiko, aber kann systemisches Risiko entfalten.
Verpflichtungen für Anbieter:
- Dokumentation (auch zu Urheberrechten),
- Transparenzpflichten,
- bei systemischem Risiko: Red-Teaming, Energie-Transparenz, Risiko-Management.
Ziel: Balance zwischen Innovation und globaler Verantwortung.
8. Innovation & Sandboxen (Erwägungsgründe 135–145)
- Rechtfertigung der Regulierungssandkästen (Art. 57 ff.).
- KI soll unter Aufsicht erprobt werden können, ohne sofortige volle Regulierung.
- Unterstützung für KMU & Start-ups → Vermeidung, dass nur Großkonzerne die Regeln erfüllen können.
- Erwägungsgründe betonen Förderung von Forschung und Bildung.
9. Governance (Erwägungsgründe 146–156)
- Begründung für das AI Office bei der Kommission (Art. 64 ff.).
- Ziel: Einheitliche Anwendung in der gesamten EU, Koordination mit Mitgliedstaaten.
- Einbindung von Stakeholdern (Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Forschung).
- Internationale Kooperation: EU-Regeln sollen globaler Standard werden.
10. Marktaufsicht & Sanktionen (Erwägungsgründe 157–165)
- Rechtfertigung der Überwachung nach dem Inverkehrbringen (Art. 72 ff.).
- Parallelen zum Produktsicherheitsrecht → Hersteller sind auch nach Markteintritt verantwortlich.
- Hohe Sanktionsrahmen (Art. 99–101) nötig, um abschreckend zu wirken – analog zur DSGVO.
11. Schlussbestimmungen (Erwägungsgründe 166–173)
Begründung für Übergangsfristen (Kapitel XIII).
Logik:
- Sofortige Anwendung für Verbote (Art. 5),
- längere Fristen für komplexe Pflichten (Hochrisiko, GPAI),
- gestaffelter Start bis 2026/2027.
Bestätigung: Ziel ist ein gleichzeitiger Schutz der Grundrechte und Förderung von Innovation.
Bedeutung der Erwägungsgründe
Sie sind nicht rechtlich bindend, aber:
- dienen Gerichten als Auslegungshilfe,
- helfen Unternehmen, die Intention des Gesetzgebers zu verstehen,
- geben Behörden Leitlinien für die praktische Umsetzung.
Besonders bei unklaren Begriffen („hochrisiko“, „systemisches Risiko“, „Transparenzpflichten“) sind die Erwägungsgründe der Schlüssel.
Kurz-Zusammenfassung
Die III. Erwägungsgründe (1–173):
- Begründen den Zweck (Schutz + Innovation).
- Erklären den Anwendungsbereich und die Definitionen.
- Rechtfertigen die Verbote (Manipulation, Social Scoring, Echtzeit-Biometrie).
- Legen die Grundidee von Hochrisiko-KI dar.
- Erklären die Transparenzpflichten (Chatbots, Deepfakes).
- Begründen die Regeln für GPAI.
- Stellen die Innovationsförderung (Sandkästen, KMU) heraus.
- Definieren die Governance-Struktur (AI Office).
- Begründen Marktaufsicht & Sanktionen.
- Erläutern die Übergangsfristen und den Inkrafttretensplan.
Fazit: Die Erwägungsgründe sind der „Kommentar des Gesetzgebers“ – ohne sie lässt sich der AI Act nur schwer korrekt anwenden.
| Inhalt |